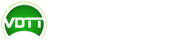Brauchen Hunde einen Rudelführer?

„Ich möchte ein guter Rudelführer sein“ – ein Satz den Hundetrainer und Verhaltensberater recht häufig von Klienten hören. Manche bieten dann auch genau das Passende an: Kurse und Seminare, Vorträge und Workshops, Verhaltensanalysen und Einzelcoachings darüber, wie der Mensch eben zum Rudelführer für seinen Hund wird. Doch solche Konzepte rufen nicht nur Begeisterung hervor, im Gegenteil. Bei manchen stößt der Rudelführer auf konsequente Ablehnung. Aber warum eigentlich?
Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Denn wer sich ihr stellt, lässt sich auf etwas ein, das kaum zu gewinnen ist: Einen Streit um Meinungen, darum, welche richtig und welche falsch ist und darum, was man denken oder glauben soll und was nicht. Und Meinungen haben es in sich. Sie sind Puzzles, die sich aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammensetzen: Aus Wissen, das verschieden sein kann, aus Vorstellungen, die verschieden sein können, aus Werten, die sich von Mensch zu Mensch ebenfalls gerne unterscheiden und aus Bedürfnissen, die zwar universell, also bei jedem gleichermaßen vorhanden, in unterschiedlichen Situationen aber stets ganz individuell gegenwärtig und bei jedem Einzelnen jeweils mehr oder weniger intensiv ausgeprägt sind. Verschieden sind also nicht nur Meinungen, Ansichten und Überzeugungen als solche. Ebenso unterschiedlich können sich die Puzzleteile zeigen, aus denen sie sich aufbauen. Für die Frage nach dem Rudelführer ist das von großer Bedeutung.
Ein Puzzle nimmt sich auseinander
Längst weiß es jedes Kind: Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Täglich entdecken wir Neues. Viel Neues. Gerade auch in Sachen Hund. Nachdem ihn die Wissenschaft jahrzehntelang beinahe wie Luft behandelt hat, ist er mittlerweile zu einem der Stars im Bereich der Forschung aufgestiegen. Fast wöchentlich verblüffen uns Wissenschaftler aus aller Welt mit neuen Entdeckungen und Erkenntnissen über Hunde. Und das obwohl wir den Hund von allen Tieren eigentlich am besten kennen. Immerhin sind Hunde ständig um uns herum. Sogar um diejenigen, die gar keinen eigenen Hund haben.
Neues Wissen kann zweierlei Nebenwirkungen mit sich bringen: Es kann neue Fragen aufwerfen, und es kann frühere Antworten infrage stellen. In der Wissenschaft passiert das ständig. Sogar mit dem, was die Wissenschaft „Lehrmeinung“ nennt, was in Lehrbüchern steht und Studenten (unter gewissem Vorbehalt – lachen Sie jetzt bloß nicht) als unumstößliche Wahrheit vermittelt wird. Die meisten Wissenschaftler sind deshalb auch Meister in Ambiguitätstoleranz. Was das ist, verrät ein Blick in die Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Dort steht:
Ambiguitätstoleranz
„Ambiguitätstoleranz“(…), teilweise auch als Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, Ambiguitäten, also Widersprüchlichkeiten, kulturell bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen und nicht negativ oder – häufig bei kulturell bedingten Unterschieden – vorbehaltlos positiv zu bewerten. (…)“
Die meisten Wissenschaftler haben kein Problem damit, Dinge, von denen sie immer überzeugt waren, plötzlich aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, Standpunkte anzupassen oder zu revidieren oder gar alte Überzeugungen zugunsten neuer komplett aufzugeben. Doch nicht nur das: Im Angesicht von sich Wandelndem schaffen sie es, wertfrei, achtsam und respektvoll auf jenes zurückzublicken, was früher Wissen (oder sogar Lehrmeinung) war und ganz oder auch nur teilweise vom neuem abgelöst wurde. Sie bringen der Arbeit ihrer Vorgänger, Lehrer und Wegbereiter Wertschätzung entgegen. Denn auch im überholtesten Wissen steckt Erkenntnis, stecken noch immer nicht gefragte Fragen, ungedachte Denkansätze und Wurzeln so manch künftiger Erklärung.
Was das mit der Frage nach dem Rudelführer zu tun hat? Eine Menge! Denn der Rudelführer in der Mensch-Hund-Beziehung ist aus früheren wissenschaftlichen Beobachtungen erwachsen. Diese Beobachtungen wurden in einer Zeit gemacht, in der man noch glaubte, alles Wissenswerte über Tiere auch dann herausfinden zu können, wenn man die jeweilige Art in einem Gehege studierte. Erik Zimen zum Beispiel war einer derjenigen, die das mit Wölfen und Hunden taten und im Zuge auch entsprechende Vergleiche anstellten. Gehegeforschung hat jedoch einen Haken: So groß, schön und naturnah ein Gehege eingerichtet sein mag, es ist bei aller Liebe nun mal nicht „Natur“. Die Insassen verhalten sich deshalb zwar in vielerlei Hinsicht durchaus so wie sie sich auch draußen verhalten würden. Aber eben nicht in jeder. Beim Wolf ist insoweit mehreres bedeutsam:
- Das klassische Wolfsrudel tritt im Freiland als Kleinfamilienverband auf, bestehend aus einem Elternpaar und den Jungen dieses und des vergangenen Jahres.
- Wenn der Nachwuchs die Geschlechtsreife erlangt, wandert er in der Regel von allein ab. Diese Abwanderung geschieht nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum, mit unterschiedlich langen Anwesenheiten und Abwesenheiten in der Familie. Ähnlich wie bei uns Menschen.
In den meisten früheren Gehegesituationen wurden keine reinen Kleinfamilien beobachtet, sondern Gruppen von Wölfen, die man als Welpen zusammenbrachte und gemeinsam aufzog. Auf diese Weise ließen sich die Studienbedingungen am einfachsten standardisieren, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die vergleichende Forschung zwischen Wolf und Hund. Gehege ermöglichen jedoch keine Abwanderung einzelner Individuen. Zwangsläufig mussten unter den Gehegeinsassen Spannungen auftreten. Die gingen in ihrer Intensität weit über das hinaus, was die Tiere unter Freilandbedingungen zugelassen bzw. ertragen hätten. Um die Spannungen zu minimieren, etablierten die Gehegewölfe die viel zitierten Rangordnungen mit „Alphatieren“ und „Omegawolf“ und vielen angst-, frustrations- und stressbedingten Begleiterscheinungen. Damit erschienen sie aber auch den Beobachtern weitaus aggressiver als sie es tatsächlich sind. Und boten eine ideale Projektionsfläche, auf die sich in Bezug auf „Machtausübung und Unterwerfung durch Anwendung von Gewalt“ so ziemlich alles malen ließ.
Manchem Zeitgenossen kam das sehr entgegen. Gerade in der Mensch-Hund-Beziehung. Ein Hund muss gehorchen, Befehle ausführen, Kommandos Folge leisten, jederzeit und unter allen Umständen – so eine gängige Devise. Geflissentlich überlasen jene Zeitgenossen, dass Zimen und andere Wissenschaftler ausdrücklich und immer wieder betonten, dass ein Rudelführer, ein „Alpha“, eben kein Herrscher ist und insbesondere kein Despot. Dass er (oder sie) niemandem vorschreibt, was zu tun und zu lassen ist, sondern im Prinzip nur gewisse Dinge für sich beansprucht, Dinge, die er individuell und situativ für sich wichtig findet. Vom Knochen über Platz bis hin zum bevorzugten Paarungspartner. Dass er aber auch keineswegs immer und unter allen Umständen auf „sein Recht“ pocht, sondern durchaus auch mal Ressourcen und Bedürfnisse anderer respektieren kann.
Warum sich ausgerechnet die Ansichten der selektiv lesenden Herrschafts-Anhänger im Umgang mit Hunden auf vergleichsweise breiter Front durchsetzten, ist schwer nachzuvollziehen. Vielleicht, weil es so einfach erscheint, einmal ein Machtwort zu sprechen oder „eine drauf“ zu geben und dann für immer Ruhe zu haben. Vielleicht, weil sich die „Krone der Schöpfung“ auch das Mitgeschöpf Tier untertan machen sollte. Oder weil viele menschliche Gesellschaften hierarchisch aufgebaut sind, im Großen wie im Kleinen, allen voran die „Ellbogengesellschaft“. Vielleicht ist auch unsere allgegenwärtige Angst schuld daran, unsere Angst, ins Hintertreffen zu geraten, wenn wir uns mal nicht durchsetzen, nicht klar machen, „wo der Hammer hängt“ und „wer die Hosen anhat“ – gerade gegenüber einem Tier. Wenn wir uns vom Hund einmal kurz weg und zu wilden Tieren hindenken, vorzugsweise zu Beutegreifern, merken wir ziemlich schnell, dass wir uns umso sicherer fühlen, je mehr Angst die wilde Spezies vor uns hat. Vielleicht schlummert ein Funke davon auch in Bezug auf unsere Hunde in uns. Selbst, wenn uns das nicht bewusst ist und wir das eigentlich auch gar nicht wollen.
Und was machen wir jetzt mit dem Rudelführer? Vergessen wir ihn einfach? Nun, einfach wird das wohl eher nicht, zudem ist die relevante Frage eigentlich eine andere: Warum sollten wir das wollen? Zumal es wahrscheinlich noch schwieriger ist, Worte aus dem Sprachgebrauch zu tilgen, als eine Rechtschreibreform durchzusetzen. Am Wort „Rudelführer“ aber fallen zwei Dinge auf:
- Rudel
- Führer, führen oder Führung.
Ein Rudelführer ist also erstmal ganz banal jemand, der ein Rudel führt. Was unter einem Rudel zu verstehen ist, wurde bereits in Worte gefasst: Definitionsgemäß bezeichnet ein Rudel eine geschlossene und individualisierte Gruppe von Säugetieren, deren Mitglieder alle derselben Spezies angehören, einander sehr genau kennen, dauerhaft zusammen leben, oft eine Rangordnung etablieren, Arbeitsteilung betreiben und eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden. Ein paar dieser Parameter treffen auf Mensch-Hund-Beziehungen zu, andere nicht. So leben Mensch und Hund in geschlossenen und individualisierten Gruppen zusammen – dauerhaft; sie sind beide Säuger und können durchaus Arbeitsteilung betreiben (man denke nur an die zahlreichen Hundeberufe). Mensch und Hund sind jedoch nicht von einer Art und bilden keine Fortpflanzungsgemeinschaft. Und auch eine Rangordnung kann, biologisch gesehen, nur zwischen artgleichen Individuen etabliert werden. Genau genommen können wir und unser Hund also gar kein Rudel bilden, sondern allenfalls eine sogenannte „gemischte Gruppe“. Und wo kein Rudel, da kein Rudelführer.
Eigentlich genau so. Eigentlich. Wissenschaftlich betrachtet. Die meisten Hundehalter sind jedoch keine Wissenschaftler. Sie reden nicht im Wissenschaftsjargon und kennen auch nicht jede einzelne Definition bestimmter Fachbegriffe. Müssen sie auch nicht. Zumal eine ganze Reihe von Fachbegriffen ganz unterschiedliche Definitionen haben, je nach dem, aus welcher Fachrichtung sie betrachtet werden. Beim Begriff des Rudels kommt die umgangssprachliche Bedeutung des Wortes ins Spiel. Und die ist so weit gefasst, dass tatsächlich alles als Rudel durchgeht, was in irgendeiner Weise als „Ansammlung Gleichgesinnter“ daherkommt. Darunter auch schon mal Horden von Teenagern auf Klassenfahrt, Schnäppchenjäger im Kaufhaus, Reitausflügler mit ihren Pferden und eben auch Menschen mit Hunden, die zusammenleben und unterm Strich eigentlich nur alle miteinander glücklich sein wollen – eben gleichgesinnt. Also doch ein Rudel. Irgendwie. Vielleicht eins in Anführungsstrichen: „Rudel“.
Ein Rudel zumal mit einer sozusagen artübergreifenden Rangordnung. Zwar können Mensch und Hund nicht um Paarungspartner konkurrieren. Wohl aber um diverse Ressourcen, etwa den besten Platz auf dem Sofa oder im Bett, den Kuchen auf dem Tisch oder die Socke, die der eine anziehen und der andere zerrupfen will. Die Strategien, als Mensch das zu erreichen, was man für sich möchte, also gegenüber dem Hund erfolgreich zu sein, sind vielfältig. Gewalt in Form von anschreien, schlagen, schubsen und ähnlichem ist eine davon. Aber (zum Glück) nicht die einzige. Hinzu kommt, dass Rangordnung zwar „Hackordnung“ bedeuten kann, wobei Hackordnung heißt, dass sprichwörtlich nach oben gebuckelt und nach unten getreten wird, wie es so schön heißt. Eine „Ordnung“ stellen aber auch Rang- bzw. Dominanzbeziehungen dar, die beschreiben, dass Individuen eben nicht immer „buckeln oder treten“, sondern sich situativ unterschiedlich verhalten können, ohne dass die Ordnung als solche (sogenannte formale Dominanz) durcheinander gerät. „Formal dominant“ ist einfach ausgedrückt immer derjenige, der dem anderen grundsätzlich überlegen ist. In Mensch-Hund-Beziehungen ist das in aller Regel der Mensch mit seinem großen Gehirn und all dem, was der Hund nicht kann und weiß. Dennoch kann auch der Hund manchmal der Überlegene sein, mit allem, was er kann und weiß und wovon der Mensch keine Ahnung hat. Als Mantrailer vermisste Menschen finden zum Beispiel. Von der formalen Dominanz ist also die „situative Dominanz“ zu unterscheiden. Und deshalb braucht kein Mensch zu befürchten, dass die Ordnung flöten geht, wenn er seinem Hund hier und da zugesteht, situativ dominant zu sein. Und zum Beispiel den besten Platz auf dem Sofa zu behalten, wenn er denn nun schon mal da liegt. Oder die Socke, die eh bald hinüber wäre. Oder eben den Kuchen. Was steht der Teller da auch so nahe an der Tischkante … .
Wer die Wahl hat, hat die Qual, heißt es so schön. Auch wenn es wissenschaftlich nicht korrekt ist, muss es kein Verbrechen sein, in Bezug auf eine Mensch-Hund-Gemeinschaft vom „Mensch-Hund-Rudel“ zu sprechen. Zumal eine Ansammlung wahrhaft Gleichgesinnter doch eigentlich etwas sehr schönes ist! Bleibt noch der zweite Teil im Rudelführer, der „Führer“. Der klingt dann gleich nicht mehr so schön, gerade hierzulande nicht. Aber: Auch wenn ein Führer ein Despot sein kann, so muss er es nicht sein. Es gibt solche und solche Qualitäten und „Qualitäten“, die einen Führer – oder eine Führungspersönlichkeit – je nach dem und mehr oder weniger auszeichnen können.
In dem Wort führen oder Führung und diversen anverwandten steckt das Folgen, das Führung automatisch nach sich zieht. Folgschaft kann erzwungen werden – muss aber nicht. Folgschaft ergibt sich auch dann, wenn sich ein Individuum mit weniger Wissen und Können an einem Individuum mit mehr Wissen und Können orientiert. Dazu müssen die Individuen nicht zwangsläufig derselben Art angehören. Hunde orientieren sich so stark wie kein anderes Haustier am Menschen (und zuweilen sogar an anderen Tieren). Wer mit seinem Hund draußen Gras für die heimischen Kaninchen sucht, stellt nicht selten fest, dass der Hund ausgerechnet dann selber an den Halmen kaut, wenn eben „Gras rupfen“ angesagt ist. Oder wenn der Vierbeiner ausgräbt, was Frauchen gerade ins Beet gesetzt hat, ganz selbstverständlich auf einem Stuhl am Esstisch Platz nimmt, sobald das Essen aufgetragen wird oder lang hingegossen auf dem Couchtisch thront, nachdem die Katze dergleichen „vormachte“. Orientierung zu geben heißt aber auch, den Hund anzuleiten, ihm Verhaltens-Strategien für Situationen aufzuzeigen und durch Training einzuüben, in denen der Hund (bekanntlich oder möglicherweise) mit „Hundestrategien“ nicht weit kommt bzw. sich und/oder andere durch ungelenktes, „eigenmächtiges“ Handeln gefährdet. Hunde sind darauf angewiesen, dass wir sie führen. Ob wir das so nennen wollen oder nicht.
Wenn Sie jetzt hin und her gerissen sind, ob Sie (noch, weiterhin oder nicht mehr) von Rudelführer bzw. Rudelführung sprechen sollen: Willkommen im Klub! Welche Entscheidung man auch immer trifft – hier und da wird man sich erklären müssen. Und sich immer wieder in Ambiguitätstoleranz üben. Brauchen Hunde einen Rudelführer? Nicht wortwörtlich. Aber sie brauchen sowas in der Art.
In einer dritten Klasse im Unterricht mit einem „Schul-Hund“ fragte eine Lehrerin einmal, warum die Menschen überhaupt Hunde haben. Die erste Antwort kam von einem sehr klugen kleinen Jungen. Und sie lautete nicht: zum Schafe hüten, als Polizeihund, als Rettungshund, Blindenführhund oder Jagdhelfer. Sie lautete: „Weil wir einen Freund brauchen“. Vielleicht würde ein kluger kleiner Hund auf diese Frage die gleiche Antwort geben. Und vielleicht tut es uns und unseren Hunden hin und wieder ganz gut, das im Hinterkopf zu behalten.
Wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, finden Sie hier einen versierten Ansprechpartner in Ihrer Nähe. Oder Sie werden selbst einer: www.atn-akademie.com.
Autorin: Judith Böhnke, in Zusammenarbeit mit Dr. Joachim Leidhold, Patricia Lösche und Yvonne Bredenbröker